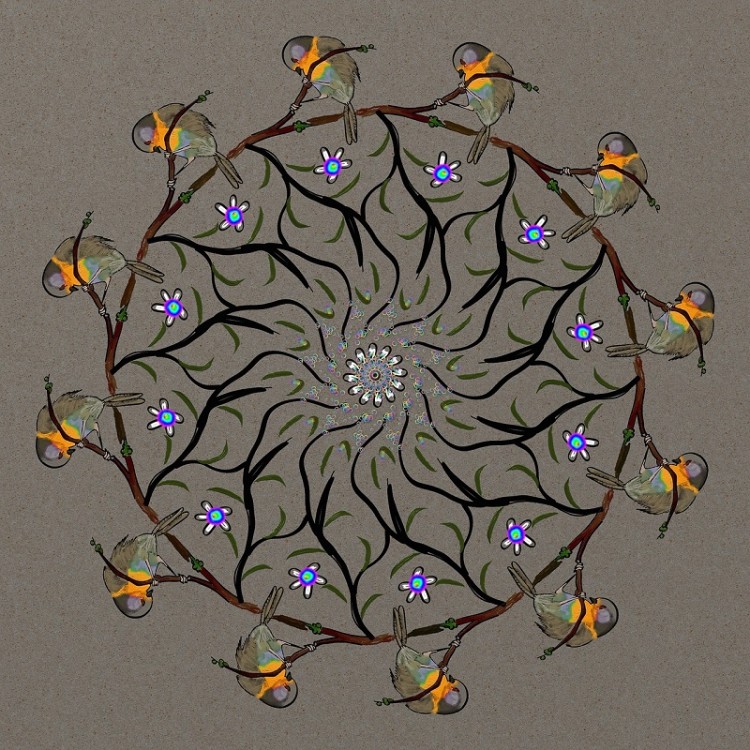Eine Muslimin, die im Zweiten Weltkrieg zur britischen Kriegsheldin wurde und von den Nationalsozialisten in Deutschland ermordet: ein wirklich ungewöhnliches Schicksal für eine Frau, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lebte.
Noor Inayat Khan kam 1914 in Moskau als älteste Tochter der Amerikanerin Ora Ray Baker und des indischen Sufis und Musikers Hazrat Inayat Khan zur Welt. Nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs zog die Familie zunächst nach London, dann nach Paris um. Noor Inayat Khan wuchs in einer kosmopolitischen und spirituellen Umgebung auf, in der ihre Haltung reifte, konsequent für die friedliche Einheit aller Wesen einzustehen. Sie studierte Kinderpsychologie an der Sorbonne, wurde musikalisch an Klavier und Harfe ausgebildet und schrieb Kolumnen für „Le Figaro“.
1940 floh die Familie vor den Nazis nach London, Noor Inayat Khan wurde Funkerin einer britischen Spezialeinheit im Nachrichtendienst, während sie weiterhin Geschichten und Erzählungen verfasste. Sie leistete gewaltfreien Widerstand gegen ein unmenschliches Regime, das Juden und viele andere erbarmungslos verfolgte und vernichtete.
Am 13. September 1944 wurde sie im Konzentrationslager Dachau erschossen, nachdem sie verraten und gefoltert wurde.

Im Jahr 2012 wurde Noor Inayat Khan, der „Sufiprinzessin“, wie sie von vielen ehrfürchtig genannt wird, ein Denkmal am Gordon Square in London gesetzt. Postum wurde sie mit dem Corix de Guerre in Frankreich und mit dem Georges Cross in England geehrt.
Das Buch König Akbar und seine Tochter: Geschichten aus einer Welt*, herausgegeben vom Inayati-Orden Deutschland e. V., enthält Geschichten, Erzählungen, Parabeln und Anekdoten, die Noor Inayat Khan verfasste.
Verfilmt wurde ihre ungewöhnliche Lebensgeschichte bisher nicht, aber zahlreiche Bücher zeichnen ihr mutiges Leben nach. Lesenswert ist beispielsweise die bisher nur auf Englisch und erstmals 2006 erschienene Biografie Spy Princess. The Life of Noor Inayat Khan* von Shrabani Basu.
weiterlesen