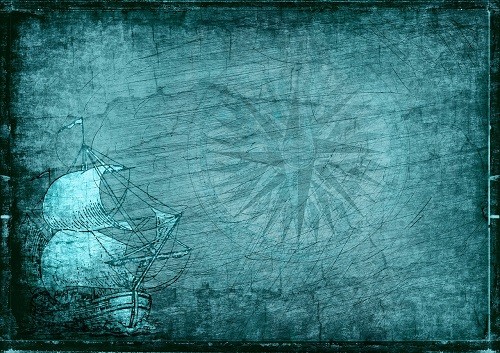Die Seidenstraße steht für eine sehr alte Handelsroute mit magischem Klang. Orte wie Samarkand, Buchara und Taschkent fallen einem vielleicht dazu ein oder unvergessene Reisende wie Marco Polo, der Ende des 13. Jahrhunderts entlang der Seidenstraße bis China reiste und für europäische Ohren damals Unglaubliches zu berichten wusste von den Wundern einer fernen Welt.
Die Seidenstraße war naturgemäß kein einzelner Weg, der schnurstracks von Asien nach Europa führte und in seiner ganzen Länge bereist wurde. Vielmehr umfasst der Begriff ein ganzes Netz an zahlreichen Wegen, die alle vor allem einem Zweck dienten: dem Handel zwischen Osten und Westen. Schon in der Antike und damit lange vor Marco Polos Zeit wurde so im Westen mit Seide aus China gehandelt, während etwa in Indien u. a. Wolle, Gold und Silber aus dem Westen begehrte Handelsobjekte waren.
Neben dem Austausch von Waren und Nahrungsmitteln war eine andere Begleitwirkung der legendären Seidenstraße mit ihren zahlreichen Kamelkarawanen, dass natürlich auch Gedanken und kulturelle Errungenschaften quasi im Vorübergehen ausgetauscht wurden. Ein solcher Austausch findet oft im Alltäglichen stand und lässt sich dann nicht genau bemessen. An besonderen Errungenschaften aber wird klar, wie wichtig die Seidenstraße für die Verbreitung war: Die Herstellung von Papier und der Buchdruck zum Beispiel gelangten mithilfe der wichtigen Handelsstraße vom Fernen Osten bis nach Europa.
Erst mit der zunehmenden Bedeutung von Schiffen und damit dem Seehandel verlor der Landweg zwischen Westen und Osten an Bedeutung. In den letzten Jahrzehnten hat man sich an die Bedeutung der Landwege erinnert, verschiedene Initiativen haben die Verbesserung der Infrastruktur entlang der alten Hauptrouten zum Ziel. Zu diesen Projekten zur Etablierung einer „neuen Seidenstraße“ gehört die von China im Jahr 2013 initiierte „Belt and Road Initiative“(BRI), mit der chinesische Wirtschaftsbeziehungen in Asien, Europa und Afrika vorangetrieben werden sollen.
weiterlesen